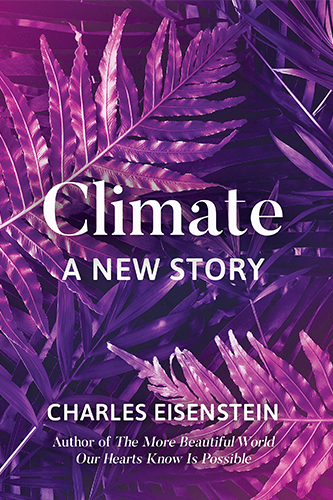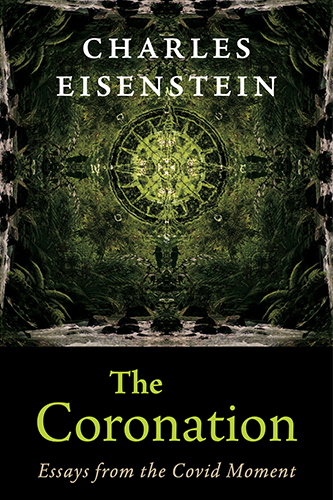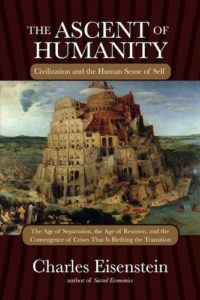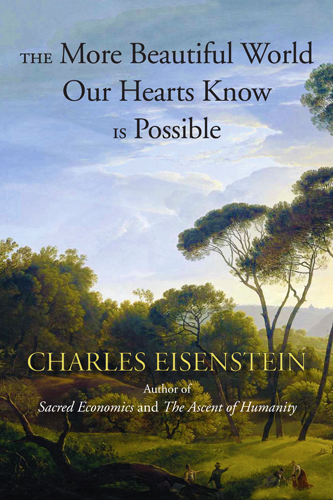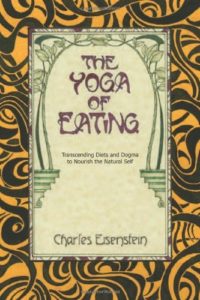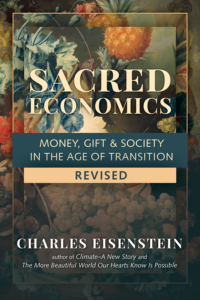Klima – eine neue Perspektive
Kapitel
Kapitel 6: Ein Pakt mit dem Teufel
Die Ursachen für unsere Untätigkeit
In weiten Teilen der Welt sind nicht die Skeptiker das größte Hindernis für Maßnahmen gegen den Klimawandel, sondern die Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit und der Politik. Sie bekunden ihren Glauben, aber glauben sie es wirklich? Ich schreibe diese Zeilen auf dem Hof meines Bruders. Wenn nun jemand käme und sagte: „Hey Charles, dein kleiner Junge läuft da draußen herum, wo wir die Giftschlange gesehen haben!“, und ich antwortete: „Ich glaube dir. Da muss ich etwas unternehmen. Ich werde mich darum kümmern, sobald ich meine Tetris-Partie beendet habe“, dann würden Sie zurecht denken, dass ich der Warnung nicht ernsthaft glaube. Vielleicht denke ich, es war nur eine Blindschleiche, oder vielleicht ist die Person dafür bekannt, gern zu übertreiben. Jedenfalls könnten Sie fest davon ausgehen, dass ich es nicht wirklich glaube, denn glaubte ich, mein Kind befände sich wirklich in Gefahr, würde ich alles stehen und liegen lassen, um es zu schützen.
Ein Großteil der Bevölkerung ist der Meinung, dass der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung für die Zivilisation darstellt, aber glauben sie das wirklich? Vielleicht stehen diese Menschen den unverhohlenen Klimaskeptikern gar nicht so fern. Die Skeptiker stehen zu ihrem Unglaube und tun das auch öffentlich kund. Der angeblich Glaubende denkt, dass er glaubt, tatsächlich aber glaubt er nicht. Hand aufs Herz: Glauben Sie es wirklich? Oder verhält es sich eher so, dass Sie manchmal verzweifeln und der Klimawandel erdrückend real erscheint, während Sie zu anderen Zeiten vorgeben, an ihn zu glauben, tatsächlich aber nicht so handeln, als ob die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel stünde? Andere Umweltschützer haben die Frage ebenfalls gestellt und dabei händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, diesen Panzer des Nichtwahrhabenwollens zu durchdringen und die Menschen zu einem aufrichtigen Glauben zu bewegen. Die übliche Strategie hierbei war die Arbeit mit der Angst. Ich behaupte, dass der Frontalangriff auf die Leugnung (die psychologische Leugnung des Durchschnittsbürgers ebenso wie die ideologische Haltung des Klimaskeptikers) unnötig ist und nicht funktioniert hat. Je übertriebener die Schlagzeilen, desto weniger Wirkung zeigen sie tatsächlich.
93% aller Nachrichten der letzten zwanzig Jahre aus dem Bereich Umwelt drehten sich um Klimawandel.[1] Es scheint gerade so, als ob jeder Artikel entweder sagte: „Schauen Sie, das Klima ändert sich wirklich“ oder „Dieser Wirbelsturm oder jenes Feuer oder diese Hungerkatastrophe ist durch den Klimawandel verursacht oder verschlimmert worden.“ Obwohl dieser Chor der Weckrufe anschwillt, glaubt die Gesellschaft als Ganzes noch immer nicht ernsthaft daran. Ganz im Gegenteil. Der Psychologe Per Espen Stoknes schreibt:
Langzeitstudien zeigen, dass sich vor 25 Jahren mehr Menschen in den wohlhabenden Demokratien Sorgen wegen des Klimawandels gemacht haben als heute. Je mehr Forschung, je mehr Sachstandsberichte des Weltklimarats wir haben, und je mehr Beweise sich aufhäufen, desto weniger sorgt sich die Öffentlichkeit. Dem rationalen Geist ist dies ein Rätsel.[2]
Stoknes erklärt dieses Rätsel in seinem Buch What We Think about When We Try Not to Think about Global Warming: Weil die Folgen des Klimawandels zeitlich und räumlich weit entfernt stattfinden, wird ihnen von den meisten Menschen weniger Dringlichkeit zugeschrieben als näherliegenden Themen. Ihnen scheint im Vergleich zur Abzahlung ihrer Hypothek oder dem Suchtproblem ihrer Tochter Klimawandel ziemlich fern und theoretisch zu sein; er findet nur in der Zukunft oder in den Nachrichten statt. Selbst wenn jemand intellektuell vom Klimawandel und der Tragweite des Problems überzeugt ist, ist das Gefühl im Alltag oft trotzdem: „Es ist nicht real“ oder „Es wird schon gutgehen“. Außerdem, so Stoknes, wird das Klimaproblem oft so bedrohlich dargestellt, dass sich die Menschen machtlos empfinden und gar nicht glauben, etwas daran ändern zu können. Gleichzeitig fühlen sie sich aber wegen ihrer Untätigkeit und ihrer eigenen Komplizenschaft an der fossilen Brennstoff-Ökonomie schuldig. Das erzeugt diverse Formen psychologischer Abwehrmechanismen, um das Schuldgefühl zu mindern.
Der Erklärung von Stoknes mit der zeitlichen und räumlichen Ferne des Klimawandels würde ich eine weitere, tückischere Art der Distanzierung beifügen: Die Abhängigkeit des Klima-Narrativs von globalen Datensätzen und Computermodellen schafft eine Kluft zwischen Ursache und Wirkung, die nur überbrückt werden kann, wenn man den Erklärungen des Wissenschaftsestablishments glaubt. Selbst für jene, die der Wissenschaft vertrauen, liegen Ursache und Wirkung hier wesentlich weiter auseinander als bei Aussagen wie: „Holzfällerei schädigt den Wald“ oder „Giftmüll verschmutzt den Fluss“.
Wenn wir sagen, dass ein Hochwasser in Bangladesch oder eine Dürre in Niger vom Klimawandel verschärft worden sei, können die Leute es nur glauben, weil die Wissenschaft es sagt. Vergleichen Sie dies mit der weiter oben besprochenen Wasser-Perspektive, der zufolge die bevorstehende Zerstörung von Feuchtgebieten in der Sahelzone durch neue Dämme verheerende Auswirkungen für das regionale (oder sogar globale) Klima haben wird: Hier haben wir eine viel kürzere Kausalkette. Wenn man Feuchtgebiete entwässert, sterben die Vögel, der Boden wird hart, die Tiere verschwinden und die Dürre verschärft sich.
Rund um den Globus machen Entwaldung, Feuchtlanddrainage, industrielle Landwirtschaft, Wasserkraftwerke und Verstädterung das Land für katastrophale Überschwemmungen, Dürren und Temperaturextreme anfällig. All das kann auf lokaler Ebene behoben werden. Das Klimawandel-Narrativ lässt das als belanglos, als einen Tropfen im Fass globaler Emissionen erscheinen. Es lenkt die Aufmerksamkeit von den Verheerungen vor Ort ab und verlagert sie auf ferne, oft hypothetische Auswirkungen.
Der von mir vorgeschlagene alternative Interpretationsrahmen mit seinem Schwerpunkt auf lokalen Ökosystemen hebt die von Stoknes beschriebenen Mechanismen der Leugnung und Lähmung auf. Man befasst sich mit konkreten Missständen und erreicht damit konkrete Ergebnisse. Die Leute können nicht die Veränderung der Konzentration eines unsichtbaren geruchlosen Gases in der Atmosphäre wahrnehmen, und sie können sich auch nicht unmittelbar der fernen Auswirkungen aufs Klima bewusst werden, aber sie können einen entblößten Berghang, Erosionsrinnen, Smog, Giftmüll, kontaminierte Gewässer usw. sehen und ihre unmittelbaren Auswirkungen spüren. Sie können auch die Rückkehr von Singvögeln und Fischen, den steigenden Grundwasserspiegel oder die zunehmende Reinheit von Luft und Wasser sehen, wo umweltfreundliche Handlungsrichtlinien umgesetzt werden.
Ein Problem bleibt jedoch bestehen: Nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels haben mit unserer alltäglichen Lebenswirklichkeit wenig zu tun, sondern Umweltzerstörung ganz allgemein. Das gilt insbesondere für die Industrieländer. Bisher können die führenden Nationen den Schaden auf Distanz halten, den die Umweltzerstörung anrichtet; darum scheint er für sie nicht real zu sein. Die Klimaanlage läuft noch, der Wagen fährt noch, die Kreditkarte funktioniert noch, die Müllwerker nehmen den Abfall mit, die Schule beginnt um 7:40 Uhr, und es gibt Essen im Supermarkt und Medizin in der Apotheke. Die Routinen, aus denen das tägliche Leben besteht, sind noch immer intakt. Wenn wir warten, bis die Katastrophe bis hierher vordringt, ist es zu spät.
Solange die normalen Routinen funktionieren, werden die meisten Menschen nicht zu überzeugen sein, ernsthaft aktiv zu werden. Mit Überzeugungsarbeit dringen wir nicht durch. Niemand kann dazu „überzeugt“ werden, sein Leben in großem Maßstab umzukrempeln, wenn das Argument nicht von einer Erfahrung begleitet ist, die auf körperlicher und emotionaler Ebene Eindruck hinterlässt.
Deshalb plädiere ich dafür, dass wir die Menschen auf andere Weise zu erreichen versuchen, egal ob das unter dem Standard-Klima-Narrativ oder dem eher lokal orientierten Umweltzerstörungs-Narrativ stattfindet, das ich vorschlage. Wir müssen die begrifflichen, emotionalen und systemischen Strukturen aufbrechen, die die Menschen von ihrer Liebe für alle irdischen Wesen trennen.
Ich wünsche mir, dass alle in der Klimawandelbewegung folgendes hören: Man kann die Menschen nicht dazu bewegen, etwas zu tun, indem man ihnen Angst einjagt. Wissenschaftliche Vorhersagen über Ereignisse in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren kümmern sie nicht – nicht genug. Wir brauchen das Ausmaß an Kraft und Engagement, das wir in Standing Rock gesehen haben. Wir brauchen die Bandbreite an Aktivismus, wie wir ihn in Flint, Michigan, gesehen haben, wo alle von der Yoga-Lehrerin bis zu Biker-Gangs unermüdlich gegen die Bleikontamination protestiert haben. Das erfordert, dass die Sache zu einer persönlichen Angelegenheit wird. Und das erfordert, dass wir der Realität des Verlusts ins Auge sehen. Der Realität des Verlusts ins Auge zu sehen nennt man Trauer. Anders wird es nicht gehen.
Der Versuch, bei Standing Rock den Bau der Dakota Access Pipeline aufzuhalten, wurde überhaupt nicht mit dem Klimawandel begründet (zumindest nicht, bis weiße Umweltschützer sich beteiligten), sondern mit dem Schutz des Wassers und der Unversehrtheit indigener Orte; nicht der Wassers allgemein und nicht aller Orte, sondern eines bestimmten Gewässers und bestimmter Orte – ganz realer Orte. Tausende von hauptsächlich jungen Menschen haben lange Reisen und widrige Umstände auf sich genommen, um daran teilzunehmen. Ein solches Engagement braucht es für die Verteidigung des Heiligen und die Verteidigung aller irdischen Wesen. Es speist sich aus Schönheit, Verlust, Liebe und Trauer.
Würden wir immer noch neue Öl- und Gasquellen anbohren, neue Pipelines bauen, neue Steinbrüche eröffnen oder neue Kohleminen graben, wenn wir aus Liebe für die Welt und das Wasser in unserer Nähe handelten? Das könnten wir nicht, und die von Menschen verursachte globale Erwärmung wäre ein rein akademisches Problem. Es stimmt zwar, dass die Standing-Rock-Bewegung die Dakota Access Pipeline nicht aufhalten konnte, aber sie machte eine enorme schlummernde Kraft sichtbar, als so viele Menschen gewillt waren, solch große Mühen für die Verteidigung des Heiligen auf sich zu nehmen. Was wäre möglich, würde diese Kraft vollständig mobilisiert?
Was geschähe, wenn wir dem Lokalen, dem Unmittelbaren, dem Qualitativen, dem Lebendigen und dem Schönen neuen Wert zumäßen? Wir würden noch immer gegen die meisten Dinge Widerstand leisten, die auch Klimawandelaktivisten bekämpfen, aber aus anderen Gründen: gegen die Teersand-Extraktion, weil sie den Wald tötet und das Land verunstaltet; gegen das Abtragen von Bergen, weil es heilige Orte vernichtet; gegen das Fracking, weil es das Wasser verletzt und kontaminiert; gegen Offshore-Ölbohrungen, weil austretendes Öl wilde Tiere vergiftet; gegen Straßenbau, weil er das Land zerstückelt, den Verkehrstod von Tieren herbeiführt, Verstädterung und Habitatzerstörung begünstigt und den Verlust von Gemeinschaft beschleunigt. Schauen Sie sich nur die Bilder von den Teersandgruben in Alberta an. Selbst wenn Sie nichts über den Treibhauseffekt wüssten, weint das Herz beim Anblick der giftigen Gruben und Becken, wo einst unberührte Wälder gestanden haben. Oder sehen Sie sich die Gasland Filme an. Lesen Sie etwas über die Ölteppiche, die das Niger-Delta verheert haben. Diese Tragödien spielen sich genau jetzt ab, und sie stechen direkt ins Herz, egal was man über globale Erwärmung denkt.
Aus diesem Blickwinkel werden wir noch immer fast alles zu ändern versuchen, was im CO2-Narrativ als gefährlich gilt, aber aus anderen Gründen und mit anderen Augen. Wir brauchen unser Umweltbewusstsein nicht mehr auf das Vertrauen in namhafte Wissenschaftler und die Autorität von Institutionen zu gründen und damit suggerieren: „Wenn die Leute nur mehr Vertrauen in Autoritäten setzten (in diesem Fall die Wissenschaft, aber es gilt für alle Systeme, in denen Wissenschaft eingebettet ist und die sie legitimieren), dann wäre alles in Ordnung.“ Wissen Sie was? Selbst wenn ich die Ansicht der Klimaskeptiker teilte, würde das meine Leidenschaft für die Umwelt kein bisschen verringern. Umweltbewusstsein kann auch geweckt werden, ohne dass man zuerst eine intellektuelle Debatte gegen die skeptischen Kräften gewinnen muss. Das wird niemanden dazu bringen, sich zu engagieren.
Wenn wir Umweltprobleme in CO2-Begriffen formulieren, erzeugen wir eine Distanz zu unmittelbarer Trauer und Entsetzen der Menschen. Wenn wir unsere Augen von den Bulldozern ab- und den Grafiken von CO2-Konzentrationen und globalen Durchschnittstemperaturen zuwenden, scheint es völlig vernünftig zu sagen: „Nun, wir werden dieses Gasfeld mit der Pflanzung eines Waldes ausgleichen. Außerdem ist es nur eine Überganglösung, bis wir genügend Windräder ans Laufen bekommen haben.“
Paradoxerweise ermöglicht die CO2-Perspektive die Fortführung von CO2-produzierenden Aktivitäten. Aus globaler Sicht ist der Treibhausgasbeitrag irgendeines örtlichen Kraftwerks oder einer Stadt vernachlässigbar. Jede Stadt kann sagen: „Wir brauchen unsere Emissionen erst zurückzuschrauben, wenn die restliche Welt es auch tut.“ Jeder Staat kann sagen: „Wir können uns die ökonomischen Kosten nicht leisten. Sollen doch andere Staaten Einschnitte machen.“ Auseinandersetzungen, die die Klimagespräche so zäh machen, sind unvermeidlich, wenn man Problem und Lösung in globalen quantitativen Begriffen ausdrückt.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit den spürbaren örtlichen Schäden zuwenden, kann man die Verantwortung nicht mehr auf andere abschieben, die sich weit weg befinden. Niemand kann sagen: „Soll doch jemand anderes unseren geliebten Berggipfel erhalten. Soll doch jemand anderes unseren geliebten Fluss bewahren. Soll doch jemand anderes unseren geliebten Wald schützen.“ Wir werden uns nicht dadurch besänftigen lassen, dass die Vernichtung unseres Lachsflusses durch ein Wiederaufforstungsprojekt in Nepal „ausgeglichen“ wird. Wenn das Sankt-Florian-Prinzip („Nicht vor meiner Tür!“) von einer mächtigen Bürgerschaft universell angewendet wird, wird daraus „Vor niemandes Tür!“
Ein Freund unserer Familie, der inzwischen verstorbene Roy Brubaker, mennonitischer Geistlicher in Zentral-Pennsylvania, organisierte eine besonders erfolgreiche Wasserschutzkampagne in einer Gegend, die politisch extrem konservativ ist: Er mobilisierte den Angler- und Schützenverein. Im ganzen Bezirk findet man kaum einen Hillary-Clinton-Wähler oder irgendjemand, der auch nur einen Finger gekrümmt hätte, wenn Roy das Thema über den Klimawandel angepackt hätte. Und nicht nur das Wassereinzugsgebiet ist verbessert worden, was sich auch weiter unten in der Chesapeake Bay positiv ausgewirkt hat; wenn die von mir hier vorgebrachte Ansicht vom lebendigen Planet stimmt, hat die ganze Welt davon profitiert.
Bedeutet es, dass wir wie gewohnt weitermachen dürfen, wenn das CO2-Narrativ nicht mehr gilt? Nein, im Gegenteil. Wie Wolfgang Sachs schon Anfang der 1990er Jahre vorausschauend bemerkt hat, sieht es so aus
als ob, nach den Jahrzehnten, in denen ‚Unwissenheit‘ und ‚Armut‘ im Vordergrund standen, nun, in den 1990er Jahren, die ‚Rettung des Planeten‘ zum Dringlichkeitsprogramm erklärt wird, das, unter großer Anteilnahme der Medien, eine weitere wilde Runde auf dem Enwicklungskarussell einläutet.[3]
Die lokalen Ökosysteme überall auf der Welt zu schützen und wiederherzustellen wird für den normalen Gang der uns vertrauten Zivilisation weitaus störender sein, als uns die fossilen Brennstoffe abzugewöhnen. Die etablierte Umweltstrategie geht davon aus, dass wir einfach dazu übergehen könnten, die Industriegesellschaft mit erneuerbaren Energien zu speisen und weiter globales Wirtschaftswachstum zu haben; daher die Ausdrücke „Green Economy“ und „nachhaltige Entwicklung“. Die Herrschenden haben kein Problem mit dem Klimawandel, solange er so konzipiert ist, dass er ihnen mehr Macht verleiht; ihnen, die, wie Sachs es ausdrückt, mit der prometheischen Aufgabe betraut sind,
[d]en weltweiten Apparat am Laufen zu halten und immer weiter zu beschleunigen und zugleich die Biosphäre des Planeten zu schützen (…).[4]
Dies, fährt er fort, wird
eine gewaltige Zunahme von Überwachungs- und Ordnungsmaßnahmen erfordern (…). Wie sonst will man die unzähligen Entscheidungen aufeinander abstimmen, die auf allen Ebenen gefällt werden, bei den einzelnen, im Rahmen der Nationen und im Weltmaßstab? Es ist dabei eher eine Nebensache, ob die Modernisierung des Industrialismus überhaupt gelingt, ob sich dabei Marktanreize als das beste Mittel erweisen, strenge Gesetze, Sanierungsprogramme, raffinierte Methoden der Ausspähung oder eindeutige Verbote – all diese Strategien erfordern jedenfalls mehr Zentralismus und vor allem eine Stärkung des Staates. Die ‚Ökokraten‘ werden wohl kaum die industrielle Lebensweise in Frage stellen, nur um die Belastung der Natur zu reduzieren, also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihr ganzes Geschick, ihren Weitblick und die neuesten technologischen Mittel einzusetzen, um die zahllosen gesellschaftlichen Aktivitäten zum Gleichlauf zu bringen.[5]
Der Klimawandel deutet auf eine Revolution der Beziehung zwischen Natur und Zivilisation hin, aber es geht nicht um eine Revolution zur effizienteren Verteilung globaler Ressourcen innerhalb des endlosen Wachstumsprogramms. Es geht um eine Revolution der Liebe. Es geht darum, den Wald wieder als heilig zu erkennen, auch die Mangroven und die Flüsse, die Berge und die Riffe – jedes einzelne von ihnen. Es geht darum, sie um ihrer selbst willen zu lieben und sie nicht nur wegen ihres Klimanutzens zu schützen.
Die Vorstellung, dass das Erleben von Schönheit und die Erfahrung von Kummer und nicht Angst vor zukünftigem Untergang tiefgreifendes und aktives Handeln für den Planeten auslösen sollen, scheint vielleicht kontraintuitiv. Viele Leute sagen mir, dass sie Umweltschützer geworden sind, als sie von den bevorstehenden katastrophalen Konsequenzen des Klimawandels erfuhren. Entsprechend haben wir uns die Sprache der Kosten und Konsequenzen in der Hoffnung zu eigen gemacht, auch andere dazu zu bringen, etwas für die Umwelt zu tun.
Aber sind Sie wirklich deswegen zur Umweltschützerin geworden? Ein psychologisches Gegenstück zur Argumentation mit Klima-Gründen, wenn wir Menschen eigentlich für andere Umweltanliegen gewinnen möchten, ist die Pflege eines Image und Selbstbildes von uns als nüchterne Realisten, wo es keinen Platz für schwammige Gründe wie Naturliebe gibt und nur rationales Nutzendenken zählt. Sie können Daten über Meeresspiegelhöhe und ökonomische Einbußen und Ernteverlustrisiken vorschieben, aber im Grunde sind Sie jemand, der Bäume umarmt: ein Ökofreak. Sie sind ein Waldliebhaber, eine Schmetterlingsguckerin, ein Schildkrötenliebkoser. Möglicherweise praktizieren Sie druidische Rituale oder verbinden sich durch Visionssuche mit Gaias Seele. All Ihre Argumente über Zukunftsfolgen, 1.5°C oder 2°C, Meter an Meeresspiegelanstieg, Hektar an Wald, Energieausbeute von Solarzellen, oder Geschwindigkeit der Methanhydrat-Ausgasung, die Sie liefern… sie legitimieren nur Ihre rührseligen Ökofreakgefühle. Doch auch dies könnte ein Faustischer Pakt sein, bei dem der Umweltschutz sich der Sprache der Macht bedient – im Tausch für seine Seele.
Der Handel wäre das vielleicht wert, wenn er tatsächlich die beabsichtigten Ergebnisse erzielt hätte. Aber das hat er nicht. Trotz der Übernahme der datenbasierten Modelle und der aus ihnen entstandenen Kosten-Nutzen-Argumente hat sich der Zustand des Lebens auf Erden stetig verschlechtert. Wir haben versucht, vernünftig zu sein. Vielleicht ist es nun Zeit, unvernünftig zu sein. Der Liebende bedarf keiner eigennützigen Gründe, seine Geliebte wertzuschätzen. Wenn wir unseren inneren Naturliebhaber annehmen und aus diesem Geist heraus sprechen, werden uns andere hören. Vielleicht haben wir die falsche Sprache verwendet, weil wir einen Geisteswandel zu erreichen versuchten, wo wir eigentlich einen Herzenswandel bräuchten.
Anmerkungen
[1]Diese Zahl habe ich völlig frei erfunden. Mein Argument erschien Ihnen überzeugender, weil es mit einer Zahl verbunden war, oder? Ich bin mir sicher, dass ich auf diese (oder jede beliebige andere) Zahl kommen kann, wenn ich die richtige Datengrundlage und Methodologie wähle; ein gutes Beispiel für die Verschleierungskraft der Zahlen. Wir müssen uns stets fragen, was hinter ihnen steckt.
[2]Schiffman (2015).
[3]Sachs (1993) S. 409f.
[4]ebd. S.425.
[5]ebd. S.425f.