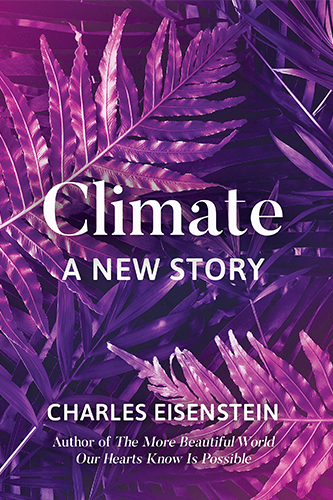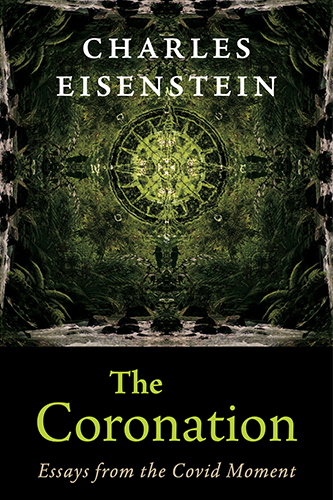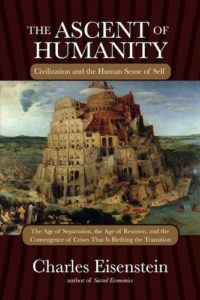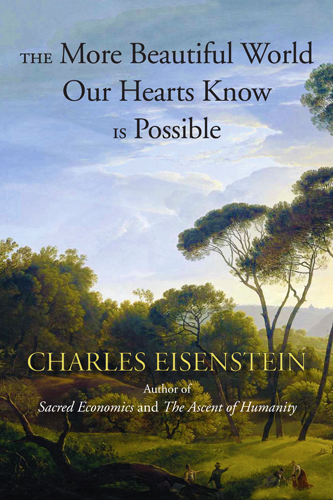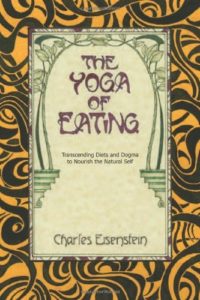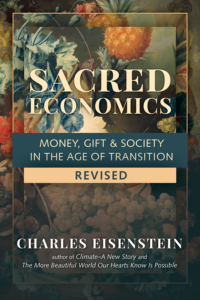Klima – eine neue Perspektive
Kapitel
Kapitel 5: Kohlenstoff und Ökosysteme
Fixiert auf Emissionen
Ich habe die Kohlenstoffbilanzierung besprochen, um zu begründen, weshalb ortsnahe, innige und aktive Fürsorge auch im Rahmen der Treibhausgaslogik „funktioniert“.
Dabei habe ich jedoch mit einem gefährlichen Reduktionismus gespielt und ein schwindelerregendes Spektrum komplexer ökologischer Wechselwirkungen einer einzigen Messlatte unterstellt: Kohlenstoffeinheiten. Ich bin das Risiko eingegangen, damit unterschwellig die Aussage zu treffen, dass diese Ökosysteme hauptsächlich wegen ihrer Fähigkeit CO2 zu binden und zu speichern von Bedeutung wären, womit ich bekräftigt hätte, dass Kohlenstoff ein gültiges Maß für die Gesundheit von Ökosystemen darstellte. Und so hätte ich an der überall verbreiteten Sichtweise mitgewirkt, dass „Umweltfreundlichkeit“ oder „Nachhaltigkeit“ gleichzusetzen ist mit niedrigen CO2-Werten.
Dass lebendige Systeme eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung eines stabilen Klimas spielen, ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet, dass unsere Welt überleben, dass sie sich potentiell an höhere Treibhausgaskonzentrationen anpassen kann. Die schlechte Nachricht ist, dass jene Ökosysteme, die das bewerkstelligen könnten, auf der ganzen Welt rapide zurückgehen. Das bedeutet, dass sich das Klima wegen der selbstverstärkenden Rückkopplungsschleifen, die bereits große Mengen Kohlendioxid und Methan aus nichtmenschlichen Quellen freisetzen, weiter destabilisieren wird, selbst wenn wir den Verbrauch fossiler Brennstoffe auf Null zurückfahren – es sei denn, wir heilen und schützen die Wälder, Mangroven, Seegräser usw.
Manche Klimawandel-Skeptiker geben zu bedenken, dass CO2-Konzentrationen und Temperaturen in früheren Epochen viel höher als heute waren und es dem Planeten damit ganz gut gegangen sei. Die Standarderwiderung darauf ist, dass die CO2-Konzentrationen noch nie so plötzlich gestiegen seien. Unabhängig davon, ob das wahr ist oder nicht, übersieht man damit eine weit wichtigere Frage: Woher kam damals die Widerstandskraft der Biosphäre? Sie gründete auf gesunden Ökosystemen. Das Leben schafft günstige Lebensbedingungen. Die Moderne aber war eine Ära des beispiellosen Sterbens.
Klimawandel-Skeptiker verkünden außerdem eine wichtige, wenn auch einseitige Wahrheit, wenn sie behaupten, dass steigende CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre ein stärkeres Pflanzenwachstum und damit mehr CO2-Absorption ermöglichen. Die Aufnahme von Kohlendioxid geschieht tatsächlich schneller als erwartet; sie ist innerhalb zehn Jahren von 40% auf 50% der Emissionen aus fossilen Energien gewachsen.[1] Es könnte funktionieren… wäre da nicht die Tatsache, dass ein Viertel bis ein Drittel der irdischen Landmassen weitgehend von Vegetation befreit worden ist und der Rest großteils durch menschliche Aktivitäten gefährdet ist. Wüsten, landwirtschaftliche Monokulturen und Straßenbelag speichern nun mal kaum Kohlenstoff.
Durch die Zerrüttung von Ökosystemen sind viele Gebiete von CO2-Senken zu CO2-Quellen geworden. Die Skeptiker haben zwar recht damit, dass CO2-Konzentrationen vor Millionen von Jahren mehrfach höher waren, und dass das Erdklima natürlichen Schwankungen unterliegt; tragischerweise jedoch haben Lebensraumzerstörung, Umweltverschmutzung, Entwicklung, Bergbau, Trockenlegung von Feuchtgebieten, Überfischung, Ausrottung von Raubtieren usw. Bedingungen geschaffen, unter denen Pflanzen und andere Lebewesen nicht mehr so flexibel auf veränderte Bedingungen reagieren, wie sie das ohne den negativen Einfluss des Menschen früher konnten. Gaia hat die Fähigkeit zur Selbstregulierung – aber wir zerstören diese Fähigkeit.
Obwohl die zentrale Rolle von Wäldern und anderen Ökosystemen für die Klimaregulierung immer deutlicher wird, und auch das weiter hinten im Buch besprochenen Potential der regenerativen Landwirtschaft, riesige Mengen an Kohlenstoff in kurzer Zeit zu speichern (und den Wasserkreislauf wiederherzustellen, was aus meiner Sicht noch wichtiger ist), zunehmend erkannt wird, verwundert es, weshalb sich die Diskussion um politisches Vorgehen so stark auf Emissionen konzentriert. Warum ist das so?
Hier ein paar der Gründe:
- Erstens ist es wesentlich einfacher, Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu messen oder zu schätzen als aus Landnutzungsänderungen. Zwar kann die Biomasse durch neue Technologien und mehr Forschung immer besser gemessen werden, aber die Zahlen variieren noch immer von Ort zu Ort und von einer Studie zur anderen. In der gegenwärtigen politischen Kultur benötigen Entscheidungsträger, Verhandlungsführer und Gesetzgeber Maßnahmen, die in Zahlen ausgedrückt werden können, damit sie Ziele, Übereinkünfte und Regeln festsetzen können, die auf einer „Kohlenstoffbilanz“ basieren. Emissionen passen daher weit besser zur politischen Kultur.
Wie viel Kohlenstoff organisches Material binden und speichern kann ist sogar noch schwerer zu messen als Biomasse. Ich habe Oswald Schmitz, einen Forscher an der Universität Yale gefragt, warum es so wenig verlässliche Daten zur Kohlenstoff-Sequestration gibt. Seine Erklärung war einfach: Es ist viel leichter, oberirdische Speicherung zu messen oder zu schätzen als unterirdische. Das beleuchtet ein allgemeines Prinzip: Wenn wir uns bei unseren Handlungsrichtlinien auf Messungen verlassen, entsteht eine Schieflage zugunsten jener Dinge, die wir messen wollen, messen können und die für Messungen zugänglich sind.
Außerdem ignorieren wir häufig das, was kulturell im toten Winkel liegt oder gängige soziale, materielle und ökonomische Praxis ist.
Im Allgemeinen ist es sehr schwierig, die Gesamtmenge an Kohlenstoff in der Erde festzustellen, geschweige denn deren Kapazität, Kohlenstoff zu binden und zu speichern. Die meisten Analysen berücksichtigen nur die obersten dreißig oder einhundert Zentimeter, aber tief wurzelnde Gräser und andere Pflanzen können Kohlenstoff weitaus tiefer einlagern.[2] Und dann gibt es da das Problem der molekularen Zusammensetzung von gelöster organischer Substanz im Boden, die beeinflusst, wie lange diese im Boden gespeichert bleibt, bevor sie wieder in den Kohlenstoffkreislauf eintritt. Die Zeitspanne hängt ebenfalls von örtlichen Bedingungen, dem Mikroklima, der Zusammensetzung der Bodenorganismen usw. ab.
- Biologische CO2-Kreisläufe (und solche anderer Treibhausgase) eignen sich im Gegensatz zu Emissionen nicht so gut zur Erstellung von Modellen. Je besser das enge Zusammenspiel zwischen Klima und Leben verstanden wird, desto schwieriger wird es. Hydrodynamik, Wärmetransport sowie Luft- und Wasserströmungen sind mit einem Computer verhältnismäßig leicht simulierbar. Das trifft jedoch nicht auf Lebensprozesse zu. Auf welche Weise unberührte Wälder das Mikroklima besser bewahren als Baumschulen, welche Rolle die wolkenimpfenden Bakterien spielen, welchen Effekt Regenwürmer auf die Zahl der Methanotrophen und welchen Einfluss die Wale auf die Nährstoffdurchmischung der Ozeane und damit auf die Plankton-Biomasse haben – diese Dinge sind schwer zu modellieren oder auch nur zu verstehen, wenn man nicht jahrzehntelang intensiv dazu geforscht hat. Wir neigen dazu, uns auf das zu konzentrieren, was zu unseren gewohnten Werkzeugen passt.
- Der Fokus auf Emissionen passt bestens zur vorherrschenden geomechanischen Sicht auf den Planeten: der Vorstellung, dass die Erde eine komplizierte Maschine und nicht ein lebendiger Organismus ist.
Moderne reduktionistische Methoden sind gut darauf abgestimmt, mit komplizierten (im Gegensatz zu komplexen) Systemen umzugehen. Bei einem komplizierten System wie einem Auto oder einem Computer mag es viele Variablen geben, aber diese sind voneinander unabhängig. Wenn das System nicht funktioniert, kann man den Fehler finden, indem man die Variablen eine nach der anderen isoliert und prüft. Man kann außerdem vorhersagbare makroskopische Effekte erzeugen, wenn man eine oder mehrere Variablen gezielt verändert. Komplizierte Systeme sind also für schrittweise Problemlösung zugänglich. Das Ganze ist die Summe seiner Teile; kausale Zusammenhänge sind im Allgemeinen linear. Wenn man ein großes kompliziertes System verstehen will, spaltet man es in viele Teile auf und setzt auf jedes ein Team an. Die akademische Welt als Ganzes spiegelt diesen Ansatz in ihrer Aufteilung in relativ autonome Disziplinen und Subdisziplinen.
Der auf Kontrolle basierende Top-down-Ansatz funktioniert für komplizierte Systeme, versagt jedoch kläglich beim Umgang mit komplexen Systeme. In einem komplexen System sind die Variablen voneinander abhängig; kausale Beziehungen sind nicht-linear und eine kleine Änderung an einem Element des Systems kann sich dramatisch auf das Ganze auswirken. Kein Teil kann isoliert verstanden werden sondern immer nur im Zusammenhang eines ausgedehnten Beziehungsgeflechts mit anderen Teilen. In komplexen Systemen ist das Ganze größer als die Summe seiner Teile. Daher muss jede reduktionistische Analyse, mit Hilfe derer das System verstanden werden soll, scheitern, und der Versuch, Variablen zu isolieren und zu ändern, wird unerwartete und unvorhersehbare Konsequenzen haben.
Körper, Ökosysteme, Genome, Gesellschaften und der Planet sind komplexe Systeme. Es besteht allerdings die Versuchung, sie trotzdem als extrem komplizierte Maschinen zu betrachten, weil wir dann unsere gewohnten Methoden der Top-down-Problemlösung anwenden und glauben können, die Situation unter Kontrolle zu haben. Kriegsdenken ist der Inbegriff dieser Illusion, wie bereits erwähnt, und das trifft auch auf jegliche Kontrolltechnologie zu: von Grenzwällen über Antibiotika bis hin zu betonierten Flussbetten. Jede führt letztlich zu unerwarteten schrecklichen Folgen und erreicht oft genau das Gegenteil von dem, was sie unter Kontrolle halten sollte (Einwanderung, Krankheiten, Überflutungen).
Jede Schilderung – und so auch das Standard-Narrativ zum Klimawandel – ist eine Linse, die einige Dinge hervorhebt und andere verdeckt. Sie verdeckt leider einige der Dinge, denen wir am meisten Aufmerksamkeit widmen müssten, wenn die Erde gesunden soll. Aus geomechanischer Sicht wurden Bodenerosion, Pestizide, Grundwasserschwund, Biodiversitätsverlust, die Rettung von Walen und Elefanten, giftiger und radioaktiver Müll usw. einst – und in vielen Fällen noch immer – als relativ unwichtig für den Klimawandel erachtet. Diese Blindheit ist erklärlich, wenn wir die Erde als enorm komplizierte Maschine auffassen. Wenn wir die Erde dagegen als lebendig betrachten, dann wird klar, dass die Zerstörung ihres lebendigen Gewebes sie natürlich ihrer Fähigkeit beraubt, mit den Schwankungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre umzugehen.
Ich will damit nicht sagen, dass Emissionen keine Rolle spielten, sondern zu einer Änderung der Prioritäten auffordern. Wir müssen auf der politischen Ebene den Schutz und die Gesundung von Ökosystemen auf allen Ebenen, und speziell der lokalen, in den Vordergrund stellen. Auf kultureller Ebene müssen wir uns als Menschen wiedereingliedern in die Familie allen Lebens und ökologische Prinzipien auch für soziale Gesundung zum Tragen bringen. Auf der Ebene von Strategie und Denken muss sich das Narrativ künftig um Leben, Liebe, Ort und Teilhabe drehen. Dann könnten wir sogar ganz aufhören, uns über Emissionen den Kopf zu zerbrechen, denn die Emissionen werden sicher sinken, wenn wir nach diesen neuen Prioritäten leben.
Anmerkungen
[1]Carrington (2016).
[2]Biodiversity for a livable climate (2017).