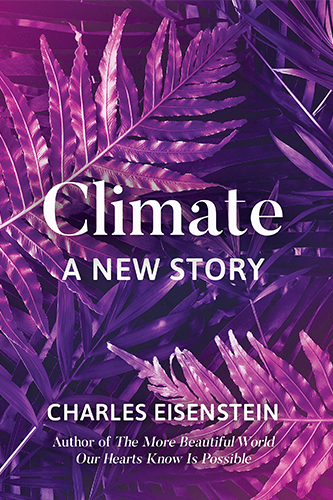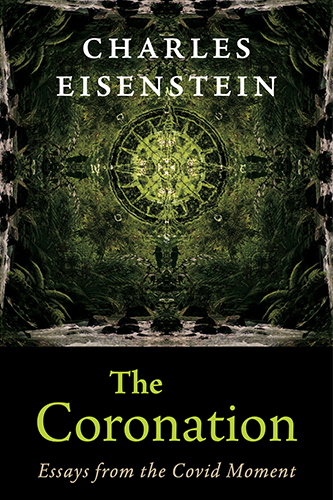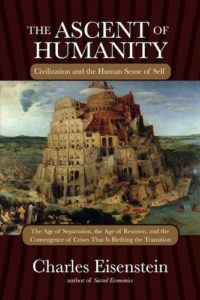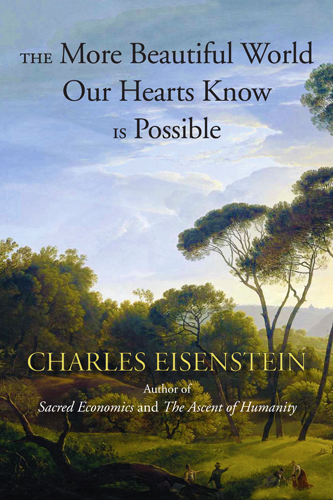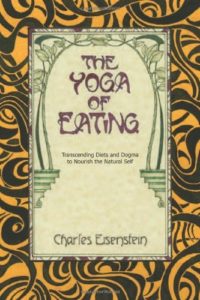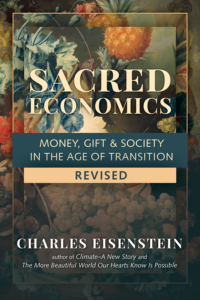Klima – eine neue Perspektive
Kapitel
Kapitel 1: Eine Krise des Seins
Der Kampf
Nichts von dem oben Gesagten soll in Abrede stellen, dass dem Leben auf diesem Planeten schreckliche Dinge widerfahren. Jemand walzt Bäume mit dem Bulldozer um, legt Feuchtgebiete trocken, fängt Fische mit dem Schleppnetz, verschmutzt Wasser, Luft und Boden. Dieser Jemand ist stets ein Mensch.
Da die meisten dieser Zerstörungen auf Geheiß von großen Unternehmen geschehen, scheint es vernünftig, jene als den Feind zu identifizieren. Entlarvt ihr unmoralisches Verhalten! Zieht sie zur Verantwortung! Schreckt sie durch empfindliche Strafen von ihren Verbrechen ab! Haltet ihr Geld von der Politik fern! So können wir wenigstens ihre schlimmsten Exzesse eindämmen.
Diese Herangehensweise ist unter den gegenwärtigen Bedingungen vernünftig, aber damit akzeptierten wir genau jene Dinge als unveränderlich, die wir verändern müssen. Ich werde später noch spezifischer auf dieses Thema eingehen; für jetzt nur etwas Allgemeines: den Feind zu bekämpfen ist aussichtslos, wenn wir in einem System leben, das endlos neue Feinde erzeugt. Das ist ein Patentrezept für endlosen Krieg.
Wenn sich das ändern soll, dann ist eine der Süchte, die wir aufgeben müssen, eine viel grundsätzlichere als die nach fossilen Energieträgern, nämlich unsere Kampfeslust. Dann können wir die Grundbedingungen untersuchen, die einen unerschöpflichen Nachschub an zu bekämpfenden Feinden produzieren.
Die Kampfsucht nährt sich aus der Vorstellung, die Welt bestehe aus lauter Feinden: gleichgültigen Naturgewalten mit der Tendenz zur Entropie und feindseligen Konkurrenten, die nur ihre reproduktiven oder ökonomischen Eigeninteressen auf Kosten unserer eigenen durchzusetzen suchen. In einer Welt voller Konkurrenten muss man Sieger sein, damit es einem gut geht. In einer Welt zufälliger Naturgewalten führt Kontrolle zu Wohlergehen. Krieg ist die Mentalität der Kontrolle in ihrer extremsten Form. Töte den Feind – das Unkraut, das Ungeziefer, die Terroristen, die Bakterien – und das Problem ist ein für alle Mal gelöst.
Außer, dass es niemals gelöst ist. Auf den ersten Weltkrieg – „den Krieg, der alle Kriege beenden wird“ – folgte schon bald danach ein weiterer, noch schrecklicherer Krieg. Und das Böse verschwand auch nicht nach der Niederlage der Nazis oder dem Fall der Berliner Mauer. Der Zusammenbruch der Sowjetunion stürzte allerdings eine Gesellschaft in die Krise, die sich vor allem durch ihre Feinde definiert hatte; deshalb folgte eine verzweifelte Suche nach einem neuen Feind in den frühen 1990ern. Zunächst fiel die Wahl auf einen schwächlichen Kandidaten, die „kolumbianischen Drogenbosse“, bevor man sich schließlich für den „Terror“ entschied.
Der Krieg gegen den Terror hauchte der auf Kriegführung basierenden Kultur neues Leben ein; er schien in der Tat sogar permanenten Krieg zu ermöglichen. Zum Bedauern des militärisch-industriellen Komplexes scheint die Öffentlichkeit immer weniger vom Terror terrorisiert zu sein, was eine Serie neuer Bedrohungen nötig macht, mit denen ein Klima der Angst aufrecht erhalten wird. Es ist schwer zu sagen, ob die Angstkampagnen der letzten Jahre – russische Hacker, islamischer Terror, Ebola, das Zika-Virus, Assads Chemiewaffen, das iranische Atomwaffenprogramm, um nur einige zu nennen – gewirkt haben. Die Medien zumindest lassen die Alarmglocken schrillen, und die Öffentlichkeit scheint mit den politischen Maßnahmen einverstanden, die durch diese Kampagnen gerechtfertigt werden, etwa mit dem massiven Pestizid-Einsatzes in Florida im „Kampf gegen Zika“. Allerdings – und das mag zum Teil meinen gegenkulturellen sozialen Kreisen geschuldet sein – habe ich keine wirkliche Furcht vor diesen Dingen gesehen, jedenfalls nicht vergleichbar mit der greifbaren Furcht vor der Sowjetunion, die in meiner Kindheit allgegenwärtig war. Die Öffentlichkeit nimmt fast alles, was die Behörden sagen, einschließlich der Angstmache, nicht mehr so ernst.
Die öffentliche Apathie erlaubt den regierenden Eliten, ihre Kontrollprogramme zu verfolgen, aber es gelingt ihnen nicht mehr mit echter Furcht Druck zu machen. Hat irgendwer außerhalb der politischen Kreise tatsächlich Angst vor dem Iran, Baschar al-Assad oder Vladimir Putin? Man könnte den Verdacht hegen, dass selbst die Politiker keine Angst haben, auch wenn sie den Anschein der Aufgeregtheit als politische Pose zu Schau stellen.
Ich bringe hier die schwindende Macht von Angstmacherei ins Spiel, weil oft genau diese Strategie im Bemühen, den ökologischen Kollaps aufzuhalten, angewendet wird. Das gängige Narrativ über den Klimawandel lautet im Grunde so: “Glauben Sie uns, schlimme Dinge werden geschehen, wenn wir uns nicht beeilen und große Veränderungen vornehmen. Es ist fast schon zu spät; der Feind steht vor den Toren!“ Ich möchte die Annahme in Frage stellen, dass wir die Öffentlichkeit mit angstbasierten Appellen ans Eigeninteresse motivieren können und sollen. Wie wäre es mit dem Gegenteil? Wie wäre es mit Appellen an die Liebe? Ist das Leben auf der Erde kostbar oder heilig an sich, oder nur wenn es für uns nützlich ist?
Der Klimawandel-Aktivismus ist voller Kriegsnarrative, Kriegsmetaphern und Kriegsstrategien. Der Grund dafür liegt, neben den tief sitzenden Gewohnheiten aus der Geschichte von der Separation, in dem Wunsch, eine Inbrunst und Selbstverpflichtung hervorzurufen, wie Menschen sie in Kriegszeiten zeigen. Dem Muster der Kriegsrhetorik folgend beschwören wir eine existentielle Bedrohung herauf.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich zögere, den Begriff „Klimawandel“ in den Titeln meiner Aufsätze zu verwenden. Das letzte Mal, als ich das tat, schrieb mir jemand: „Ich hätte Ihren letzten Beitrag fast nicht gelesen, denn er hatte das Wort Klimawandel im Titel, und ich bin es einfach leid, immer und immer wieder dasselbe zu hören.“
Vielleicht werden wir kriegsmüde. Braucht es mehr und mehr Brandreden, um Sie dazu zu bringen, in eine weitere Schlacht zu ziehen? Fühlen Sie sich ausgebrannt, wenn kein neues Entsetzen Sie mehr zum selben Engagement animieren kann, das Sie noch vor ein paar Jahren gezeigt haben? Das Ausbrennen scheint für einen Aktivisten das Ende zu sein; folgt man aber der Geschichte vom Mann im Labyrinth, kann es sogar der notwendige Ausgangspunkt für eine völlig andere Herangehensweise an Engagement sein.
Meine gute Freundin Pat McCabe, eine Frau der Diné (Navajo) und langjährige Schülerin des Lakota-Wegs, drückt es so aus: „Wenn du ans Ende deiner Kräfte kommst, dann geschehen Wunder.“ Wenn wir ausschöpfen, was wir wissen, dann wird das, was wir nicht wissen, möglich.
Wenn man voller Kummer über die Vernichtung des Lebens auf Erden ist, mag es verständlich erscheinen, wenn man jeden Vorschlag, „den Kampf aufzugeben“, als Affront ansieht. Für jemanden, der von der Kriegsmentalität durchdrungen ist, bedeutet den Kampf aufzugeben zugleich jegliches Handeln aufzugeben. Ich schlage vor, den Kampf in einem anderen Sinne aufzugeben: als Orientierungsprinzip für unsere Bemühungen, die Erde zu heilen. Es mag weiterhin Konflikte geben, aber wir werden Zugriff auf viel größere Heilkräfte bekommen, wenn wir das Thema innerhalb eines friedlichen Rahmens angehen.
Es wurde oft gesagt, dass der letzte große Krieg, der unzweideutig seine Ziele erreicht hat, der Zweite Weltkrieg war. Seitdem sind militärische Konflikte für die stärkere Seite gewöhnlich in Pattsituationen, im Morast oder im Debakel geendet. Dass beispielsweise der Krieg in Afghanistan ein Fehlschlag war, liegt nicht an minderwertigen Waffensystemen. Die Waffensysteme sind für die angestrebten Ziele unzureichend, denn diese können nicht erzwungen werden. Gewehre und Bomben können meist keine Stabilität bringen, „Herz und Verstand erobern“ oder ein Land pro-amerikanisch machen, außer es handelt sich eindeutig um die Rettung eines Volkes vor Despoten und Aggressoren[1]. Um Krieg zu rechtfertigen, müssen wir jede Situation in dieses Schema hineinzwingen, und die Medien haben dies bei jedem Konflikt seit Vietnam versucht.
Dasselbe gilt für nicht-militärische Kriege. Zu meinen Lebzeiten wurden ein Krieg gegen die Armut, einer gegen den Krebs, einer gegen Drogen, einer gegen den Terror, einer gegen den Hunger und nun einer gegen den Klimawandel ausgerufen. Und bis jetzt haben wir mit ihnen auch nicht mehr erreicht als mit dem Krieg im Irak.
Wenn der „Kampf“ gegen den Klimawandel ein Krieg ist, ist klar, welche Seite gewinnt. Die Treibhausgasemissionen haben unablässig zugenommen, seit sie in den späten 1980ern das erste Mal von einer größeren Öffentlichkeit als Problem erkannt wurden. Das Waldsterben hat sich seitdem ebenfalls fortgesetzt und in manchen Gebieten sogar beschleunigt. Es hat auch keinen Fortschritt bei der Umstellung der grundlegenden Infrastrukturen unserer Gesellschaft von fossilen auf erneuerbare Energieträger gegeben. Wäre Krieg die einzige Handlungsmöglichkeit, dann müssten wir noch heftiger kämpfen. Wenn es einen anderen Weg gibt, wird die Gewohnheit zu kämpfen zum Hindernis für den Sieg.
Im Falle der totalen Umweltzerstörung ist die Kriegsmentalität nicht nur ein Heilungshindernis, sondern ein integraler Teil des Problems. Krieg basiert auf einer Art Reduktionismus: er reduziert komplexe, wechselseitig verflochtene Ursachen – uns selbst eingeschlossen – auf eine einfache, externe Ursache, genannt Feind. Dieser wird oft entwertet, karikiert und entmenschlicht dargestellt. Die Dämonisierung und Entmenschlichung des Feindes unterscheidet sich nur wenig von der Entweihung der Natur, die die Voraussetzung für deren Zerstörung ist. Die Natur zum Anderen zu machen, zu etwas, das weder Ehrfurcht noch Respekt verdient, zum Objekt, das dominiert, kontrolliert und unterworfen werden muss, gleicht der Entmenschlichung und Ausbeutung von anderen Menschen.
Respekt für die Natur kann nicht vom Respekt für alle Wesenheiten – einschließlich der Menschen – getrennt werden. Das eine bedingt das andere. Der Klimawandel ruft uns deshalb zu einer tiefergreifenden Transformation auf, es geht nicht nur um den Austausch unserer Energieträger. Er fordert dazu auf, die grundlegende Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen zu transformieren, einschließlich, aber nicht ausschließlich der Beziehung zwischen dem kollektivem Selbst der Menschheit und der Natur als dem Anderen.
Die philosophisch geneigte Leserin mag protestieren, das Selbst und das Andere seien in Wahrheit nicht getrennt, oder die Mensch-Natur-Unterscheidung sei ein künstlicher, falscher und schädlicher Gegensatz, eine Erfindung des modernen Denkens. In der Tat legt die „Natur“ als separate Kategorie nahe, dass wir Menschen unnatürlich wären und deshalb potentiell über die Naturgesetze erhaben. Welche Metaphysik dem auch immer zugrunde liegen mag, was sich ändert, ist unsere Mythologie. Wir waren nie von der Natur getrennt und werden es auch nie sein, aber die dominante Kultur auf der Erde hat sich lange Zeit als getrennt von der Natur begriffen und meinte sich dazu bestimmt, sie eines Tages zu transzendieren. Wir haben in einer Mythologie der Separation gelebt.
Teil der Mythologie der Separation ist der Glaube an eine verdinglichte Natur; mit anderen Worten, der Glaube, dass nur die Menschen volles Bewusstsein besitzen. Das erlaubt uns, die Wesen der Natur für unsere eigenen Zwecke auszubeuten, so wie die Entmenschlichung anderer Ethnien den hellhäutigen Menschen erlaubte, diese zu versklaven.
Die Auffassung der dominanten Kultur darüber, wer als volles Subjekt gilt, als bewusst und würdig, ein Selbst zu besitzen, hat sich in den letzten paar hundert Jahren erweitert. Vor zwei oder drei Jahrhunderten galten nur besitzende, weiße Männer als vollwertige Subjekte. Dann wurde diese Kategorie auf alle weißen Männer ausgedehnt. Schließlich wurden auch Frauen und Menschen anderer Hautfarbe aufgenommen. Dann kam die Tierrechtsbewegung mit der Forderung, dass auch Tiere Bewusstsein, Subjektivität und ein inneres Leben haben und daher nicht als bloßes Vieh oder Fleisch-Maschinen behandelt werden dürfen. Auch zur Intelligenz von Pflanzen, Myzelien, Böden und Wäldern sind unlängst wissenschaftliche Entdeckungen gemacht worden und sogar über die Fähigkeit des Wassers, komplexe, dynamische Informationsmuster zu übermitteln. Diese Entdeckungen nähern sich anscheinend der allen indigenen Völkern gemeinsamen Überzeugung an, dass alles lebt und Bewusstsein hat.
Fanatismus und Umweltzerstörung beruhen auf der Entmenschlichung oder der „Ent-Selbstung“ des Anderen. Die Gegenteilige Sichtweise führt zu einer Geschichte vom Interbeing. Noch einmal, dieser Begriff geht über bloße wechselseitige Vernetzung und Abhängigkeit hinaus und meint, dass wir existentiell mit allen anderen Wesen und mit der Welt insgesamt verbunden sind. Mein ureigenstes Sein hat Teil an Ihrem Sein und dem Sein der Wale, der Elefanten, der Wälder und der Meere. Was ihnen geschieht, geschieht auf einer gewissen Ebene auch mir. Wenn eine Art ausstirbt, stirbt auch etwas in uns; wir können der Verarmung der Welt, in der wir leben, nicht entrinnen.
Dies trifft in gleicher Weise auf das ökologische, ökonomische und politische Wohlergehen zu. Die Tage des Kolonialismus und Imperialismus, in denen der Wohlstand einer Nation auf der Plünderung von anderen beruhte, sind gezählt. Die Ära des Glaubens, dass der Wohlstand der Menschen auf der Plünderung der Natur aufgebaut werden kann, ist ebenfalls fast vorüber. Sicherlich erscheinen beide Formen von Plünderung äußerlich so robust wie eh und je oder gar schlimmer denn je zuvor. Allerdings ist ihr ideologischer Kern ausgehöhlt. Die konvergierenden Krisen sind eine Initiation für die Menschheit in die neue und gleichzeitig uralte Mythologie des Interbeing.
Später werde ich zu zeigen versuchen, dass die Klimakrise eigentlich etwas anderes ist als das, was wir uns im Allgemeinen darunter vorstellen. Aber Vorstellungen sind wichtig. Klimawandel bedeutet im Kern, dass wir am Ende einer Ära angelangt sind. Wir sind am Ende des Zeitalters der Separation. Es ist ein Übergang, der nun schon seit drei Generationen in Gang ist. Er wurde durch die Anwendung der extremsten aller möglichen Kontrolltechnologien auf dem Höhepunkt des Totalen Krieges ausgelöst. Ich spreche natürlich von der Atombombe.
Das Zeitalter des Krieges kam 1945 zu seinem passenden Ende, als die Menschen zum ersten Mal in der Geschichte eine Waffe entwickelt hatten, die zu schrecklich war, um sie zu anzuwenden. Es brauchte zwei Grauen erregende Anwendungen der Atombombe, um den Boden für Jahrzehnte eines „Gleichgewichts des Schreckens[2]“ zu bereiten, ein Aufglimmen der evolutionären Einsicht, dass das, was wir dem Anderen antun, uns selbst antun. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein totaler Krieg zwischen den Supermächten unmöglich. Heutzutage wird bis auf eine uneinsichtige Minderheit niemand erwägen Atomwaffen zu verwenden, selbst in Situationen, wo Vergeltung unwahrscheinlich ist. Radioaktive Verstrahlung macht einen Einsatz im großen Maßstab undenkbar, aber es gibt auch einen anderen Grund, der uns zurückhält. Wir könnten es vielleicht Gewissen oder Ethik nennen, aber die Geschichte macht auf tragische Weise deutlich, dass Gewissen und Ethik allein nicht hinreichen, um Dummheit und Grauen zu unterbinden. Nein, etwas anderes hat sich verändert.
Was sich nach meinem Dafürhalten geändert hat, ist das beginnende Aufkeimen eines Bewusstseins des Interbeing in der vorherrschenden Zivilisation. Was wir dem Anderen antun, tun wir uns selbst an. Diese Einsicht wird prägend sein für die nächste Zivilisation – wenn es eine nächste Zivilisation geben sollte. Und jetzt steht für uns (für gewöhnlich spreche ich in diesem Buch von „wir“, wenn ich die dominante Kultur auf diesem Planeten meine) Lektion Zwei in Sachen Interbeing an. Lektion Eins war die Atombombe. Lektion Zwei ist der Klimawandel.
[1]Manche meinen, das wahre Ziel der Kriege in jüngerer Zeit war es, Chaos zu verursachen und den Widerstand souveräner Regierungen gegen neoliberale Freihandelspolitik und imperialistische geopolitische Zielsetzungen zu brechen. Unter diesem Gesichtspunkt waren einige Kriege, wie etwa jener, der Jugoslawien zersplitterte, oder der, der Libyen zerstörte, große Erfolge. Nichtsdestoweniger trifft es zu, dass wir mit den Werkzeugen des Krieges jene Ziele immer weniger erreichen, die wir offiziell erreichen wollen.
[2]Anm. d. Ü.: Englisch: Mutually Assured Destruction – MAD. US-Nukleardoktrin. Ungefähr: Gegenseitig zugesicherte Zerstörung.