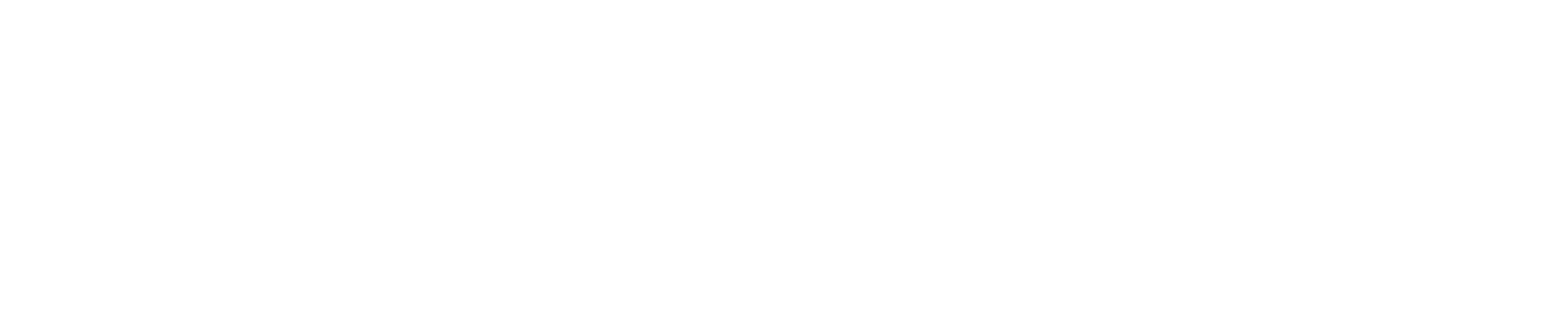Unorthodoxe Gewässer
Eine Rezension von Gerald Pollack’s Buch „Wasser – viel mehr als H2O“
In „Wasser- viel mehr als H2O“ bietet Gerald Pollack eine elegante neue Theorie der Wasserchemie an, die nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf Chemie und Biologie hat, sondern die auch auf die Grundlage unseres Verständnisses der Wirklichkeit und unseres Umgangs mit der Natur übertragen werden kann.
Ich möchte betonen, dass es sich hier nicht um ein New-Age-Buch von jemandem mit fragwürdigen wissenschaftlichen Referenzen handelt. Dies ist ein Buch über Chemie, wenn auch ein für Laien leicht zugängliches. Pollack ist ein vielfach ausgezeichneter Professor an der Universität von Washington, Autor zahlreicher von Experten begutachteter Veröffentlichungen, Träger der Prigogine-Medaille 2012 und Herausgeber der akademischen Zeitschrift „Water“. Ich erwähne dies, weil es hier um ein Gebiet geht, das von manchen als „Pseudo-Wissenschaft“ abgestempelt wird. Ich bezeichne es jedoch höflich als spekulative, von wissenschaftlicher Starrheit unbelastete Untersuchung. Denn Theorien, die auf solch einem Gebiet Paradigmen sprengen, ziehen manchmal ein Übermaß an Feindseligkeit auf sich.
In der Tat widmet Pollack eines der ersten Kapitel zwei solcher Episoden: Dem Polywasser-Debakel der 1960er Jahre und der Kontroverse um das Wassergedächtnis zwanzig Jahre später. Diese werfen Licht auf die Politik der „Wissenschaft als Institution“ und die Methoden, mit denen nicht damit konform gehende Ansichten unterdrückt werden. Darüber hinaus enthüllen sie, wie ich später noch erwähnen werde, auch einige der unantastbaren metaphysischen Annahmen, die der Wissenschaft, wie wir sie kennen, zugrunde liegen – Annahmen, gegen die das vorliegende Buch indirekt verstößt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es in wissenschaftlichen Kreisen mit gemischten und in einigen Fällen ausgesprochen frostigen Gefühlen aufgenommen wurde. Und das, obwohl in „Wasser – viel mehr als H2O“ auf jegliche Schärfe oder Verleumdung verzichtet wird, die so manches unorthodoxe Buch im Tonfall anschlägt. Der Stil ist höflich, unterhaltsam und vorsichtig, wenn es um die Präsentation eher spekulativer Ideen geht.
Man sollte meinen, dass nach zweihundert oder mehr Jahren moderner Chemie etwas so Grundlegendes und scheinbar Einfaches wie das Wasser inzwischen gut erforscht ist. Bevor ich dieses Buch las, hatte ich die Erklärungen, die meine High-School- und College-Lehrbücher für die Verdunstung, die Kapillarwirkung, das Gefrieren, die Bildung von Blasen, die Brownsche Molekularbewegung und die Oberflächenspannung lieferten, niemals in Frage gestellt. So geht es allen anderen wohl auch, was vielleicht der Grund dafür ist, dass die konventionellen Erklärungen nur selten kritisch überprüft werden. Doch wie „Wasser – viel mehr als H2O“ zeigt, offenbart schon ein bisschen kreatives Hinterfragen schwerwiegende Mängel in den konventionellen Erklärungen.
In dem Buch geht es hauptsächlich um das "Ausschluss-Zonen-Wasser", oder kurz EZ-Wasser[1]. Stellen Sie sich ein Reagenzglas mit Wasser vor, in dem Hunderttausende von Kunststoff-Mikrokügelchen schweben. Gemäß der Standardchemie sollten diese gleichmäßig im gesamten Medium verteilt sein – und sie befinden sich fast überall im Wasser. An den Wänden des Reagenzglases und an jeder hydrophilen[2] Oberfläche, die ins Wasser getaucht wird, bleibt das Wasser jedoch klar und frei von jeglichen Kügelchen. Warum? Die Standardchemie beschreibt eine wenige Moleküle starke Ausschluss-Zone unmittelbar am Glas, in der elektrisch geladene Wassermoleküle an den verteilten Ladungen haften. Die von Pollack beobachtete Ausschluss-Zone war jedoch mindestens einen Viertelmillimeter – mehrere hunderttausend Moleküle – stark.
Pollack und seine Kollegen gingen vorsichtig vor, testeten und schlossen schließlich verschiedene konventionelle Erklärungen für das Phänomen (z.B. Konvektions-Strömungen, die Bildung von Polymer-Bürsten, elektrostatische Abstoßung und undichte Materialien) aus. Sie begannen auch, die Eigenschaften der Ausschluss-Zone zu untersuchen, mit verblüffenden Ergebnissen: EZ-Wasser schließt fast alles aus, nicht nur Schwebeteilchen, sondern auch gelöste Stoffe. Es weist eine elektromagnetische Absorptionsspitze bei 270 nm auf und gibt weniger Infrarotstrahlung ab als das Wasser außerhalb der Ausschluss-Zone; es hat eine höhere Viskosität und einen höheren Brechungsindex als das restliche Wasser. Die größte Überraschung war zu entdecken, dass die Ausschluss-Zone insgesamt negativ geladen war und dass das angrenzende Wasser einen niedrigen pH-Wert hatte, was darauf schließen ließ, dass Protonen – positiv geladene Teilchen - irgendwie aus dem Wasser der EZ hinausbefördert worden waren.
Mit diesen Informationen stellten Pollack und seine Mitarbeiter die Hypothese auf, dass sich die Ausschluss-Zone aus einer flüssigkristallinen Form von Wasser zusammensetzt, bestehend aus übereinander gestapelten sechseckigen Schichten aus Sauerstoff und Wasserstoff in einem Verhältnis von 2:3. Natürlich besteht auch Eis aus gestapelten sechseckigen Waben, aber in Eis werden diese Schichten durch die zusätzlichen Protonen zusammengehalten. Pollack schlägt vor, dass die EZ-Schichten "aus der Reihe tanzen". Sie sind so ausgerichtet, dass die Sauerstoffanteile jeder Schicht häufig neben den Wasserstoffanteilen der benachbarten Schichten liegen. Die Ausrichtung ist nicht perfekt, aber sie produziert mehr Anziehung als Abstoßung, genug, um sowohl Kohäsion , als auch eine molekulare Matrix zu erzeugen, die dicht genug ist, um selbst die kleinsten gelösten Stoffe auszuschließen.
Woher kommt die Energie, um diese Ladungstrennung zu erzeugen? Sie kommt von einfallender elektromagnetischer Strahlung. Wenn eine Wasserprobe von einfallender Strahlung und Wärmefluss abgeschirmt wird, bildet sich keine Ausschluss-Zone.
Der größte Teil des Buches „Wasser – viel mehr als H2O“ ist der Anwendung dieser Hypothese auf verschiedene Phänomene der Wasserchemie gewidmet. Meiner Meinung nach liegt Pollacks größte Stärke als Wissenschaftler darin, scheinbar naive Fragen zu stellen, die sonst niemand stellt. Zum Beispiel stellt er die herkömmliche Erklärung der Oberflächenspannung in Frage, die sich auf den durch Wasserstoffbrücken gebildeten Druck auf der Wasseroberfläche beruft. Kann die außergewöhnliche Oberflächenspannung von Wasser wirklich durch die Energie in einer weniger als einen Nanometer starken Schicht erklärt werden? Er fragt, warum läuft aus Gelen, die zu über 99,9% aus Wasser bestehen können, kein Wasser aus? Warum verdichten sich geladene Aerosol-Wassertröpfchen zu Wolken, anstatt sich gegenseitig abzustoßen und sich gleichmäßig am Himmel zu verteilen? Warum gefriert heißes Wasser manchmal schneller als kaltes Wasser (der Mpemba-Effekt)? Warum kommt der Dampf, der aus einer Tasse heißen Kaffees aufsteigt, in einzelnen Dampfwölkchen? Warum hinterlassen Boote manchmal 15 oder 30 Minuten nach ihrem Vorbeifahren eine sichtbare Zone von relativ stillem Wasser?
Dieses Buch bietet außergewöhnlich ergiebige Antworten auf diese Fragen und noch mehr. Die von Pollack beschriebenen Experimente sind unkompliziert und überzeugend. Obwohl sie höchst unkonventionelle Antworten auf grundlegende Fragen der Chemie liefern, schreibt er dies nicht übernatürlichen oder paranormalen Kräften zu. Er stellt auch keine grundlegenden physikalischen Gesetze (der Thermodynamik, Relativitätstheorie, Quantentheorie usw.) in Frage. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen: Warum wird seine Theorie dann ignoriert?
Ich denke, der Grund dafür geht über den gängigen Kuhn‘schen Widerstand gegen jeglichen Paradigmenwechsel hinaus. Pollack ist schließlich nicht der erste Wissenschaftler, der in Schwierigkeiten gerät, weil er Theorien über Wasser vorantreibt, die darauf hindeuten, dass es mehr als eine austauschbare, strukturlose Substanz ist, mehr als ein Medium für die Chemie, mehr als ein Rohstoff für die Chemie. Hier handelt es sich um etwas anderes.
Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der beiden zuvor erwähnten Kontroversen, Polywasser und das Wassergedächtnis, ist hier aufschlussreich. Erstgenanntes entdeckten russische Chemiker. Sie fanden, dass Wasser in engen Röhren anomale Eigenschaften aufweist, dass es weder flüssig noch fest ist (die Anomalien sind genau dieselben, die Pollack beschreibt). Es folgte ein Aufruhr, und westliche Wissenschaftler warfen den Russen vor, sie hätten es versäumt, Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen – nämlich Spuren von gelöstem Siliziumdioxid aus den Glasröhren. Am Ende gaben die Russen zu, dass das Wasser unrein war, und die Entdeckung wurde in den Mülleimer der Geschichte verbannt. Niemand bot jedoch eine Erklärung dafür an, wie gelöstes Silizium diese anomalen Eigenschaften verursacht haben könnte. Pollack weist darauf hin, dass das wirklich reine Wasser, das universelle Lösungsmittel, fast unmöglich zu erhalten ist. Das Wesentliche der Entdeckung der Russen wurde nie genauer untersucht; vielmehr wurde ein bequemer Vorwand gefunden, um die Entdeckung zu disqualifizieren.
Der Fall „Wassergedächtnis“ ist noch ungeheuerlicher. 1988 veröffentlichte Jacques Benveniste in der Zeitschrift „Nature“ einen Artikel, in dem er behauptete, dass eine Wasserprobe, die zuvor Antikörper enthalten hatte, immer noch eine Immunantwort der weißen Blutkörperchen hervorruft, als ob sich das Wasser an die Anwesenheit der Antikörper "erinnern" würde. „Nature“ veröffentlichte den Artikel (Benveniste war ein französischer Top-Immunologe), schickte dann aber einen Untersuchungsausschuss, zu dem auch der professionelle Magier James Randi und der Ermittler für Forschungsbetrug Walter Stewart gehörten. Über die weiteren Geschehnisse wird unterschiedlich berichtet, aber alle sind sich einig, dass keine direkten Beweise für Betrug gefunden wurden. Das Team kam nur zu dem Schluss, dass die Ergebnisse nicht reproduzierbar waren, eine Behauptung, die Benveniste energisch, aber erfolglos zurückwies: Seine Forschungsgelder wurden gestrichen, sein Labor wurde ihm weggenommen, und seine akademische Karriere war ruiniert. Bis heute ist sein Name mit „pathologischer“ Wissenschaft verbunden, und seine Nachrufe stellen meisterhaft dar, wie Rufmord betrieben werden kann.
Beachten Sie, dass ich im vorigen Absatz das Wort "erinnert" in Anführungszeichen gesetzt habe, als ob ich dem Leser versichern wolle, dass ich nicht glaube, dass Wasser buchstäblich Erinnerungen haben kann. Die Anführungszeichen sollen sagen, dass sich Wasser bestenfalls so verhalten kann, als könne es sich erinnern. Denn schließlich ist es doch nur Wasser, oder? Es besitzt nicht die Komplexität, die Organisation, die Intelligenz, die erlebende Wesenheit, all das, was notwendig wäre, um tatsächlich Erinnerungen zu haben. Die moderne Chemie behauptet genau das: Dass Wasser eine gewöhnliche Flüssigkeit ist, von der zwei beliebige Proben grundsätzlich identisch sind und sich nur durch Temperatur und mögliche Verunreinigungen unterscheiden (und durch die Wasserstoff-Isotopenverhältnisse, für alle Pedanten unter Ihnen).
Polywasser, das Gedächtnis des Wassers und Pollacks Theorie verletzen alle dieses Prinzip, das in Wirklichkeit eine Art von Anthropozentrismus ist. Unsere Zivilisation – insbesondere in ihrem Umgang mit der Natur oder mit Gebrauchsgütern – geht davon aus, dass nur wir Menschen die Eigenschaften eines Selbst haben. Der Rest der Welt ist nur ein Haufen Zeug da draußen; daher steht es uns frei, diesen Rest der Welt nach Belieben auszubeuten und unsere Intelligenz einem gefühllosen Substrat aufzuzwingen, dem jegliche Intelligenz fehlt. Jede wissenschaftliche Theorie oder Technologie, die gegen dieses Prinzip verstößt, erscheint dem Verstand, der nach diesem Prinzip arbeitet, sofort falsch, ja sogar empörend.
Der Wandel, den unsere Gesellschaft heute durchmacht, zeigt sich darin, dass wir immer mehr Existierendem ein „eigenständiges Selbst“ zugestehen. Etwas, was wir vorher nur uns Menschen zugeordnet hatten. Wir haben schon einige Fortschritte gemacht: Heute erkennen wir die volle Rechtsfähigkeit von Frauen und Minderheiten verschiedener Rassen an (obwohl leider rassistische und sexistische Überzeugungen viel hartnäckiger fortbestehen, als die meisten weißen Männer wahrhaben wollen). Wir sehen Tiere nicht mehr als gefühllose, rohe Wesen an, obwohl auch hier die Art und der Grad der Intelligenz von Tieren nur unzureichend verstanden wird. Sogar die Pflanzenintelligenz entwickelt sich zu einem heißen Forschungsthema, obwohl es nur wenige Wissenschaftler gibt, die sagen würden, "Pflanzen sind intelligent" oder "Pflanzen haben ein subjektives Erleben", ohne sich gleichzeitig durch unzählige Erklärungen und Relativierungen abzusichern und zu vermitteln: "Natürlich sage ich nicht, dass Pflanzen tatsächlich intelligent sind".
Um es klarzustellen: Auch Gerald Pollack sagt nicht, dass Wasser intelligent ist. Seine Forschung öffnet jedoch die Tür zu einer solchen Sichtweise, denn sie impliziert, dass zwei beliebige "Proben" von reinem H2O einzigartig sind, mit einer Struktur, die davon abhängt, womit das Wasser in Kontakt gewesen ist. Warum habe ich hier "Probe" in Anführungszeichen gesetzt? Weil das Wort selbst impliziert, dass, wenn ich eine kleine Menge Wasser aus einer größeren Menge, z.B. ein Reagenzglas aus der Badewanne, entnehme, die kleinere Menge die gleichen Eigenschaften hat wie die größere. Mit anderen Worten geht man davon aus, dass Wasser oder irgendetwas, von dem ich eine Probe nehme, grundsätzlich von seiner Umgebung isolierbar ist.
Pollacks Forschung stellt beide Annahmen – Einheitlichkeit und Isolierbarkeit – in Frage. Er geht nicht so weit, zu behaupten, dass Wasser Informationen transportieren kann, aber er kommt dem nahe, wenn er anmerkt, dass bei verschiedenen Materialien auch die Eigenschaften der Ausschluss-Zone variieren. Das ist vielleicht der Grund, warum Homöopathen seine Forschung aufgegriffen haben (wie sie es auch bei Benveniste getan haben). Natürlich ist die Homöopathie in den Augen der medizinischen Orthodoxie der Inbegriff von Quacksalberei; ihre Verbindung mit Pollacks Werk (obwohl er selbst nie einen Anspruch darauf erhebt) ist sicherlich ein Grund, warum das wissenschaftliche Establishment seiner Arbeit gegenüber misstrauisch ist.
Kein sachlicher Beobachter würde sagen, dass er die Gültigkeit der Homöopathie "bewiesen" hat, ganz zu schweigen von der bunten Vielfalt an wasserbasierten Verfahren oder diversen Produkten, die man im Internet finden kann. Aber wenn wir seine Ergebnisse akzeptieren – und ich hoffe, dass andere Wissenschaftler seine Experimente wiederholen und ausweiten – kann man zumindest nicht mehr sagen, dass bestimmte Ansätze nicht zu bezweifelnden wissenschaftlichen Prinzipien widersprechen. Falls zwei beliebige Proben von reinem Wasser identisch sind, dann sind strukturierte Wasserprodukte und Medikamente natürlich Blödsinn. Dank Pollack (und den ihm in dieser Forschung vorangehenden Wissenschaftlern, auf deren wissenschaftliche Literatur er sich bezieht) ist dies nicht mehr sicher.
„Wasser – viel mehr als H2O“ trägt zu einem viel größeren Paradigmenwechsel quer durch alle Wissenschaften bei und tatsächlich zu einem Wandel in der Mythologie, die unsere Zivilisation bestimmt. Allein in der Naturwissenschaft sind die Auswirkungen seiner Erkenntnisse – wenn sie bestätigt werden – tiefgreifend; insbesondere in Bereichen wie der Zellbiologie, der Pflanzenphysiologie, im Bezug auf chemische Botenstoffe und natürlich auf die Medizin. Darüber hinaus kratzen sie an der Geschichte, dass wir in einem toten Universum aus austauschbaren Substanzen leben, dass wir, die einzige Intelligenz dieses Universums, daher seine rechtmäßigen Herren und Meister sind. Pollack ist Teil der Entwicklung der Wissenschaft hin zu einer schamanischeren Weltanschauung, die versteht, dass alle Dinge eine Art von Wesenhaftigkeit besitzen.
Der Widerstand gegen diesen Wandel ist immer noch groß, vielleicht weil seine Folgen so gewaltig sind. Selbst ohne sich der enormen Größe der daraus resultierenden Folgen bewusst zu sein, greifen orthodoxe Denker instinktiv jede Arbeit an, die mit diesem Wandel in Einklang steht. Eine verbreitete Taktik ist der Vorwurf der "Verunreinigung", die (zusammen mit Betrug) in der Archäologie und sogar in der Astronomie sowie in der Chemie als Totschlagargument gegen anomale Ergebnisse eingesetzt wird. Es läuft auf den Vorwurf der Schlamperei, der Inkompetenz hinaus. Niemand will für einen Dummkopf gehalten werden; deshalb schweigen die heimlich Sympathisierenden, wenn die Ausgrenzung unorthodoxer Denker wie Benveniste, Pollack, Pons und Fleischmann, Halton Arp usw. beginnt, weil sie zu Recht um ihre Forschungsgelder und ihre Karriere fürchten.
Obwohl ich vermute, dass Gerald Pollack dem größeren Wandel in der Mythologie der Zivilisation wohlwollend gegenübersteht, gibt es in dem Buch dafür kaum Anzeichen. Er beschränkt sich auf die Chemie und macht, wenn er sich in den Bereich der Spekulation wagt, deutlich, dass er sich auf unsicheres Gelände begibt. Vielleicht werden sein unaufgeregter Ton, seine Überlegungen zu alternativen Erklärungen und sein Festhalten an experimentell begründeten Behauptungen ein wenig dazu beitragen, die natürliche Skepsis des wissenschaftlich-orthodoxen Lesers zu mildern. Aber ich bezweifle es. Die radikalen Implikationen dieses Werkes sind zu beeindruckend und zu tief.
[1] Anm. der Übersetzerin: Der englische Begriff dafür ist „exclusion zone“.
[2] Anm. d. Ü.: wasserliebenden, Wasser nicht abstoßenden